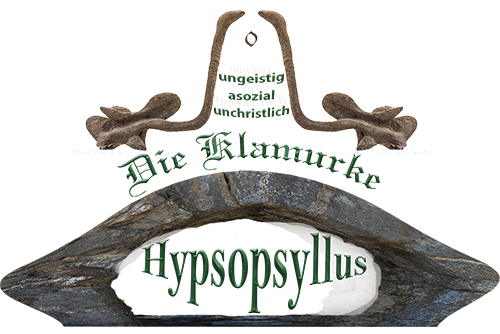
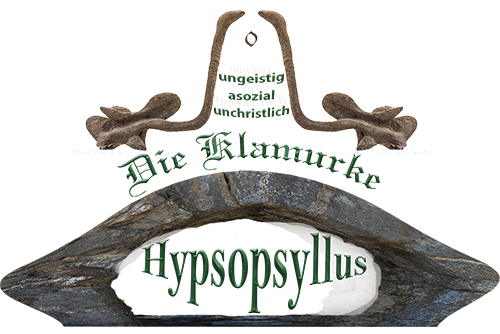

[…]
Es ist ja wohl gerade an der deutschen Sprache zu beobachten, wie sich in der Sprache eines Volkes durch die Entwickelung dieser Sprache auch die Entwickelung des Seelenlebens selber ausdrückt. Nur muß man sich klar darüber sein, dass nicht in jedem Zeitabschnitt der Mensch zu der Sprache im gleichen Verhältnis steht wie in einem anderen Zeitabschnitt. Je weiter wir zurückgehen in der Entwickelungsgeschichte eines Volkes, desto lebendiger finden wir in gewisser Beziehung alles das, was an Kräften der menschlichen Seele und auch an Biegsamkeitskräften des menschlichen Leibes mit der Sprache zusammenhängt. Ich habe das ja selbst des öfteren empfunden. Wenn Sie meine Bücher durchgehen, so werden Sie das ganz bewusste Bestreben finden, selbst bei philosophischen Themen möglichst in deutscher Sprache zu sprechen. Das wird mir ja gerade übelgenommen von manchen Gegnern, die dann nicht anders können als gegen das zu wettern, was in bewusster Art gerade in diesen Büchern für die Sprache angestrebt wird.
Es ist heute schon im Deutschen außerordentlich schwierig, gewissermaßen noch innere lebendige Kräfte zu finden, welche die Sprache weitergestalten. Namentlich ist es schwierig, Sinnangliederungen zu finden, also einen gewissen Sinn in einer völlig adäquaten Weise dadurch auszudrücken, dass man versucht, irgendein Wort aufzunehmen, wie ich es zum Beispiel versucht habe mit dem Worte kraften, ein Wort, das sonst in der deutschen Sprache weniger gebraucht wird. Da versuchte ich, in Aktivität zu versetzen, was sonst nur mehr passiv ausgedrückt wird. Auch mit anderen Wörtern habe ich dergleichen versucht; aber trotzdem wir nur um ein Jahrhundert hinter Goethe liegen, wird es uns heute schon schwer, so weitgehende neue Wörter zu prägen, die prägnant Dinge ausdrücken, welche wir als neue Gedanken der Zeitentwickelung einzuverleiben versuchen. Wir denken nicht daran, dass zum Beispiel das Wort Bildung nicht älter ist als die Goethe-Zeit! Vor der Goethe-Zeit gab es in Deutschland noch keinen gebildeten Menschen, das heißt man sagte zu dem, was man da meinte, noch nicht ein gebildeter Mensch. Die deutsche Sprache hatte noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine starke innere plastische Kraft, und so konnten solche Worte, wie Bildung oder gar Weltanschauung, das auch erst seit der Goethe-Zeit auftritt, noch gebildet werden. Es ist ein großes Glück, in einem Sprachzusammenhang zu leben, der solche innere Bildung noch zuläßt. Man merkt das ja insbesondere stark, wenn man zum Beispiel in der Lage ist, immerfort von der Übersetzung seiner Bücher ins Französische oder Englische oder in andere Sprachen einiges zu hören. Da übersetzen die Leute im Schweiße ihres Angesichts, so gut sie es können; aber immer, wenn einer etwas übersetzt hat, findet es der andere spottschlecht, keiner findet die Übersetzung gut. Und wenn man auf die Sachen eingeht, so kommt man darauf, dass vieles, wie es da in den Büchern steht, in der Übersetzung so nicht gesagt werden kann. Ich antworte dann den Leuten: Im Deutschen ist alles richtig; man kann das Subjekt an erster, an zweiter, an dritter Stelle setzen, da ist mehr oder weniger noch alles richtig. - Und die pedantische, philiströse Einrichtung, dass etwas nicht gesagt werden kann im Absoluten, ist im Deutschen noch nicht so vorhanden wie bei den westlichen Sprachen. Aber denken Sie, wohin man gekommen ist, wenn man an eine stereotype Ausdrucksweise gebunden ist! Man kann da noch nicht individuell denken, sondern eigentlich nur im Gruppengeist Dinge denken, die man den anderen Menschen mitteilen will. Das ist auch für die Bevölkerung der westlichen Zivilisationen in hohem Grade der Fall; sie denken in stereotypen Ausdrucksformen. Sehen Sie, gerade an der deutschen Sprache kann man Beobachtungen machen, wie dasjenige, was ich den Sprachgenius nennen möchte, allmählich versteift ist, wie man in unserer Zeit sich auch schon mit dem Deutschen dem Stadium nähert, wo man nicht mehr aus den stereotypen Formen herauskann. Das war in der Goethe-Zeit nicht so, und noch weniger so in noch früheren Zeiten. Und das hängt wohl zusammen mit der gesamten Sprachentwickelung Mitteleuropas. […]

